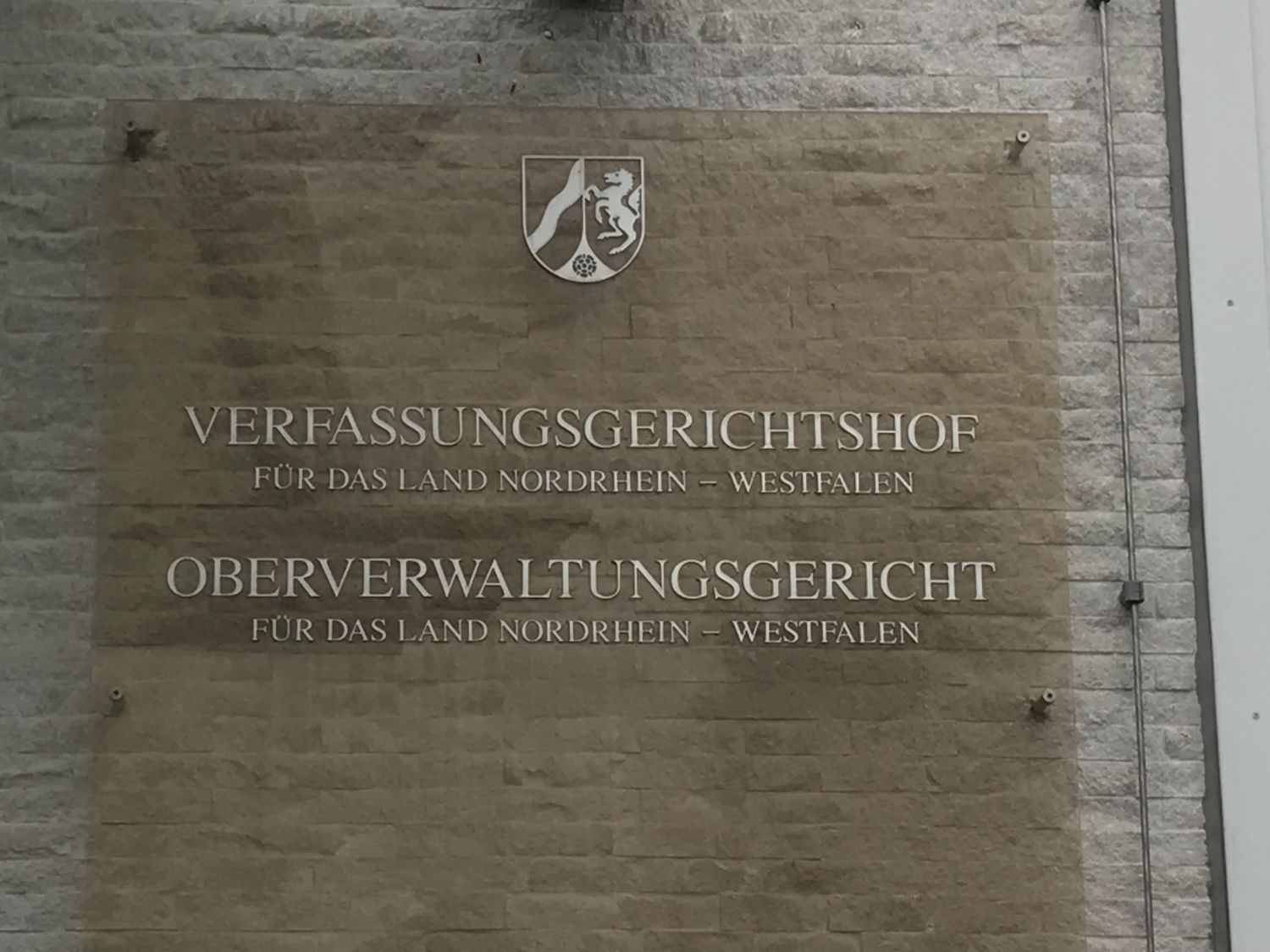Landesverfassungsbeschwerden in Nordrhein-Westfalen – Was Bürger nun wissen müssen
Der nordrhein-westfälische Landtag hat im Sommer 2018 die Einführung der sogenannten Individualverfassungsbeschwerde beschlossen, also einer Landesverfassungsbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster. Das Gericht war für Bürger bislang unerreichbar, wie die Verfahren funktionieren werden ist noch weitgehend unbekannt, vor allem aber: Was steckt in den NRW-Landesgrundrechten? Rechtsanwalt Robert Hotstegs erklärt im Gespräch mit 123recht.de die Hintergründe.
Seit dem 1. Januar sind Verfassungsbeschwerden beim Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen möglich
123recht.de: Herr Hotstegs, wie sind Sie in das neue Jahr gestartet? Müssen seit dem 1. Januar die ersten Verfassungsbeschwerden geschrieben oder abgeschickt werden?
Rechtsanwalt Hotstegs: Nein, so plötzlich kamen und kommen sie dann wohl doch nicht ab dem allerersten Tag. Jedenfalls nicht in der Masse. Aber theoretisch konnte es tatsächlich in der letzten Woche losgehen. Die gesetzlichen Grundlagen gibt es, der Verfassungsgerichtshof hat seine Geschäftsordnung im Herbst entsprechend angepasst. Auch elektronischen Rechtsverkehr ermöglicht er. Wer also Anlass hätte, sich über die Verletzung seiner Rechte aus der Landesverfassung zu beschweren, könnte sogar vom PC aus versuchen, den Verfassungsgerichtshof an Neujahr anzurufen.
123recht.de: Hat die Landesverfassungsbeschwerde bislang gefehlt?
Rechtsanwalt Hotstegs: Ja, manche sind der Auffassung, dass es sich um eine Art Schlussstein im Rahmen der Verfassungsgebung des Landes handelt. Denn die Verfassung hat das Land sich ja schon 1950 gegeben. Seitdem verfügen die Nordrhein-Westfalen auch auf Landesebene garantiert nicht nur über die Rechte des Grundgesetzes, sondern über eigene Landesgrundrechte. Und auch den Verfassungsgerichtshof in Münster gibt es schon seitdem. Er war aber für Bürgerinnen und Bürger – mit Ausnahme von Wahlanfechtungsverfahren – eigentlich nicht erreichbar. Er war, so wie man es in diesen Tagen oft hört, eher ein Staatsgerichtshof, also ein Gericht zur Klärung der verfassungsrechtlichen Verhältnisse von Landtag – Landesregierung –Abgeordneten – Fraktionen und Parteien untereinander. Den meisten Bürgern dürfte unbekannt sein, dass es dieses Gericht überhaupt gibt.
123recht.de: Hatte der Verfassungsgerichtshof also bislang keine Relevanz?
Rechtsanwalt Hotstegs: Doch, er hat gleich mehrfach etwa das Kommunalwahlrecht maßgeblich beeinflusst, indem er nämlich zuletzt Ende 2017 eine Sperrklausel auf kommunaler Ebene als landesverfassungswidrig gekippt hat. Das betrifft jede und jeden Wahlberechtigten. Ebenso haben Städte und Gemeinden oft den Gerichtshof angerufen, in den 70er Jahren wegen der kommunalen Neugliederung, später vor allem wegen Finanzierungsfragen. Für die Gemeinden gab es auch bislang eine eigene Verfassungsbeschwerde. Sie durften also bislang ihre Selbstverwaltungsrechte einklagen.
Der Bürger hat die Wahl: Bundesverfassungsgericht oder Verfassungsgerichtshof
123recht.de: Die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe war bislang schon möglich. Bleibt sie erhalten? Wo liegt der Unterschied zur Landesverfassungsbeschwerde?
Rechtsanwalt Hotstegs: Natürlich ist der Gang nach Karlsruhe weiter möglich, das Bundesrecht bleibt ja von der Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes (VGHG NRW) unberührt. Der Bürger hat aber in vielen Fällen zukünftig die Wahl. Ist etwa ein Rechtsstreit vor den Gerichten des Landes rechtskräftig entschieden worden und ist er der Meinung, durch das letztinstanzliche Urteil würde er in seinen Grundrechten verletzt, kann er dies entweder vor dem Bundesverfassungsgericht oder vor dem Verfassungsgerichtshof geltend machen. Karlsruhe wacht über die Grundrechte des Grundgesetzes, Münster über die Grundrechte der Landesverfassung. Sie sind teilweise deckungsgleich, die Landesgrundrechte gehen aber noch weiter.
123recht.de: Kann jeder Betroffene also parallele Verfassungsbeschwerden einreichen?
Rechtsanwalt Hotstegs: Bloß nicht. Denn wenn die Streitgegenstände der beiden Beschwerden identisch sind, führt dies zur Unzulässigkeit der Landesverfassungsbeschwerde, übrigens völlig unabhängig davon, ob das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht am Ende erfolgreich ist oder nicht. Der Gesetzgeber will keine doppelte Befassung der Gerichte. Beschwerden nach Münster und Karlsruhe machen also ausschließlich dann Sinn, wenn der Streitgegenstand unterschiedlich ist.
123recht.de: Worin unterscheiden sich denn die Grundrechte? Welche zusätzlichen Grundrechte gewährt die Landesverfassung?
Rechtsanwalt Hotstegs: Das wird die neue Rechtsprechung im Einzelnen zu klären haben. Denn bislang haben wir eine rein literarische Diskussion in den Kommentaren. Art. 17 LVerf garantiert die Förderung der Erwachsenenbildung, Art. 18 Abs. 3 LVerf die Sportförderung, Art. 24 Abs. 2 LVerf den Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. Sind das nun Grundrechte des Einzelnen gegen den Staat? Kann ein einzelner in ihnen verletzt sein? Die Fachgerichte haben derartige Fragen bislang selten klären müssen oder vielleicht auch selten klären wollen, dazu ist nun der Verfassungsgerichtshof berufen.
„Theoretisch kann jede und jeder mit der Befähigung zum Richteramt berufen werden“
123recht.de: Wer entscheidet dort im Verfassungsgerichtshof, kennt man die Richterinnen und Richter?
Rechtsanwalt Hotstegs: Es handelt sich um sieben Mitglieder, eine Präsidentin, eine Vizepräsidentin und fünf weitere gewählte Mitglieder. Die Präsidentin ist nach altem Landesverfassungsrecht zugleich die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts, die Vizepräsidentin ist die Präsidentin des OLG Köln. Diese beiden sind für die Dauer ihrer Amtszeit im Hauptamt berufen und sozusagen im Nebenamt Verfassungsrichterinnen. Die weiteren Mitglieder sind auf die Dauer von zehn Jahren gewählt, zuletzt im Sommer 2018. Es handelt sich dort sowohl um Berufsrichter aus der Verwaltungs-, Finanz-, Sozial- und Zivilgerichtsbarkeit wie auch um Professoren verschiedener Hochschulen und verschiedener Rechtsgebiete.
123recht.de: Es handelt sich also um ein ausschließlich ehrenamtliches Gericht?
Rechtsanwalt Hotstegs: Das Gesetz schweigt dazu. Aber es ist klar, die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs werden nicht hauptamtlich berufen. Sie werden nicht zu Richterinnen oder Richtern des Landes ernannt. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung je nach Sitzungsmonat und Sitzungstagen. Theoretisch kann also jede und jeder mit der Befähigung zum Richteramt berufen werden, sofern ernicht auf Bundes- oder Landesebene bestimmten Gremien (etwa Bundestag, -rat oder Landtag) angehört und sofern er nicht im öffentlichen Dienst tätig ist.
123recht.de: In das Bundesverfassungsgericht wurde jüngst ein Rechtsanwalt und Abgeordneter des Bundestages berufen. Prof. Dr. Stephan Harbarth ist dort nun Vorsitzender des Ersten Senats und Vizepräsident. Wäre das auch für den Verfassungsgerichtshof denkbar?
Rechtsanwalt Hotstegs: Selbstverständlich. Schon jetzt können auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte durch den Landtag zu Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs gewählt werden. Soweit ersichtlich, ist das aber jedenfalls in der jüngeren Vergangenheit nicht vorgekommen. Ich hielte das aber für eine durchaus richtige und gute Wahl. Der Deutsche Anwaltverein und die Bundesrechtsanwaltskammer haben in der Vergangenheit für anwaltliche Expertise am Bundesverfassungsgericht geworben. Die gleichen Argumente greifen auch beim Verfassungsgerichtshof. Auch dort dürfte in Zukunft anwaltliche Expertise hilfreich sein. Warten wir die nächste Jahre ab, ob die jetzt bestehende Größe des Gerichts ausreicht und auch, ob es bei nebenamtlichen Richtern bleiben kann.
123recht.de: Halten Sie hauptamtliche Richter für notwendig?
Rechtsanwalt Hotstegs: Die Zahl der Verfassungsbeschwerden wird hierfür maßgeblich sein. Sieben Richter können nach heutigem Stand entweder als Senat im Plenum entscheiden oder aber auch in Kammern zu drei Richtern unzulässige und offensichtlich unbegründete Verfassungsbeschwerden zurückweisen. Was aber ist, wenn in Zukunft auch zulässige und begründete Verfassungsbeschwerden erhoben werden? Dem Rechtsschutz ist das doch zu wünschen und dann stößt das Gericht an seine Grenzen. Dann braucht es nämlich mehr Arbeitskraft. Entweder hinter den Kulissen durch wissenschaftliche Mitarbeitende oder eben durch mehr Mitglieder oder deren vollständige Arbeitskraft im Hauptamt. Ich finde es spannend, das zu beobachten.
123recht.de: Vielen Dank für diese ersten Einschätzungen.
Robert Hotstegs ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht in der Hotstegs Rechtsanwaltsgesellschaft, Düsseldorf. Er ist Lehrbeauftragter der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW und Autor des im Januar erscheinenden Handkommentars „Verfassungsbeschwerde.NRW“ (ISBN978-3-7481-5650-5).